Vielfalt statt Einfalt
Heterogenität – ein Wort, das einem im Alltag eher selten begegnet. Am ehesten vielleicht noch verwandte Begriffe, wie etwa das Adjektiv „homogenisiert“ beim morgendlichen Blick auf die Milchflasche oder der Begriff „Heterosexualität“, wenn AFD und CSU einmal mehr eine Rückbesinnung auf die „klassische“ Familie fordern.
Doch was bedeutet Heterogenität – also die Uneinheitlichkeit der einzelnen Mitglieder einer (Lern-)Gruppe basierend auf verschiedenen Merkmalen (bspw. Herkunft, Religion, sexuelle und geschlechtliche Identität) – in der Lehre eigentlich?
Heterogenität bedeutet Multiperspektivität
Für mich birgt Heterogenität in der Lehre vor allem eines: eine Chance. Eine Chance, die Lehrenden wie die Lernenden in ihrer Unterschiedlichkeit anzuerkennen und diese als verbindendes Element, als gemeinsame Basis zu begreifen und zu nutzen. Denn eine größere Verschiedenheit auf beiden Seiten ermöglicht auch eine größere Vielfalt an Positionen und schafft eine Multiperspektivität, die in homogenen Gruppen nicht erreicht werden kann und die für alle Beteiligten ein Zugewinn ist.
Demgegenüber steht eine vergleichsweise „homogene“ Lehre, welche die Diversität der Lernenden und Lehrenden nicht berücksichtigt und dadurch zwangsläufig von einer Einheitlichkeit ausgeht. Sie birgt die Gefahr der Perpetuierung bestehender Perspektiven und Positionen und führt letztendlich zur Stärkung von Hegemonien.
Ohne Vielfalt keine Repräsentation
Wie sich dies aus studentischer Perspektive anfühlt, habe ich selbst vor einigen Jahren im Rahmen eines ERASMUS-Stipendiums an der University of Sheffield in Großbritannien erleben dürfen. Neben der sehr guten Ausstattung der Universitäten dort ist mir vor allem eines aufgefallen: Es gab wenig Heterogenität unter den Studierenden. Der Großteil meiner Kommiliton*innen verfügte über einen hohen sozioökonomischen Status, kaum eine*r musste arbeiten oder war auf ein Stipendium angewiesen. Die sogenannte „Arbeiterklasse“ – die in Großbritannien viel stärker als solche benannt wird – war fast gar nicht vertreten. Dieser Umstand war vor allem der enormen Höhe der englischen Studiengebühren geschuldet. Als Arbeiterkind empfand ich dies vor allem in den Seminaren als irritierend, denn ich hatte das Gefühl, dass es an unterschiedlichen Perspektiven und Standpunkten in den gemeinsamen Diskussionen mangelte. Argumentiert wurde meist aus einer weißen, heterosexuellen, finanziell besser gestellten Position heraus, die vieles als selbstverständlich gegeben annahm und andere Positionen entweder übersah oder gänzlich negierte. Dies stand im krassen Gegensatz zur Stadt Sheffield an sich, die als durch den Strukturwandel gebeutelte ehemalige Stahlstadt (ähnlich dem Ruhrgebiet) vor allem durch eine starke Arbeiterklasse und vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit geprägt war. Während wir in frisch renovierten Räumlichkeiten mit modernster Technik über verschiedene gesellschaftliche Themen diskutierten, blieben die Perspektiven und Positionen derer, denen wir auf dem täglichen Weg in die Universität oder beim Einkaufen begegneten, außen vor. Verstärkt wurde dieser Eindruck noch durch die damaligen Studentenunruhen, die sich aufgrund der neugewählten konservativ-liberalen Regierung (Regierungskoalition der Torys und der Liberal Democrats unter David Cameron, 2010) entluden, aber keinerlei Berücksichtigung im Unterricht fanden.
Genauso verhielt es sich mit der Thematisierung von Positionen außerhalb des heteronormativen Spektrums. Obwohl die Universität zu dieser Zeit eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Gay Icons Project“ startete, in deren Rahmen zahlreiche queere Künstler*nnen und deren Werk thematisiert wurden (Oscar Wilde, Jackie Kay, Anne Lister, Benjamin Britten etc.), blieb selbst bei der Analyse von Wildes „The Picture of Dorian Gray“ diese Perspektive größtenteils unerwähnt. Zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, mich zwischen zwei verschiedenen Welten zu bewegen, die keinerlei Berührungspunkte aufwiesen. Meine Umgebung – das Stadtviertel in dem ich wohnte, die Angestellten im lokalen Supermarkt, die Freunde, mit denen ich feiern ging oder mich im Pub traf – schien zu verstummen und unsichtbar zu werden, sobald ich den Seminarraum betrat. Sie und damit auch ich – sofern ich nicht selbst Stellung bezog – waren in den Diskussionen nicht repräsentiert.
Hochschulen als Begegnungsorte
Wenn aber die anderen – oft als Minoritäten betrachteten – Positionen und Perspektiven nicht gehört werden, ist der Diskurs unvollständig. Heterogenität innerhalb der Studierendenschaft hilft dabei, eigene Meinungen und Standpunkte in der Diskussion – also im Abgleich mit anderen – zu entwickeln und zu vertreten. Sie eröffnet einen Raum, in dem auch Dinge geäußert werden können, die einer – wie auch immer gearteten – Mehrheit gar nicht bewusst sind, weil sie außerhalb von deren Wahrnehmung und Lebensrealität stattfinden. So schafft ein bewusster Umgang mit der vorhandenen Heterogenität der Studierenden ein umfassenderes Verständnis für und Wissen um Perspektiven und Positionen, die im Alltag häufig unterrepräsentiert sind. Die daraus entstehende Multiperspektivität kann zu einer distinguierteren Untersuchung des jeweiligen Themas oder Gegenstandes führen.
Heterogenität adressieren
Durch meine Erfahrungen in Großbritannien habe ich sehr zu schätzen gelernt, dass ein Hochschulstudium in Deutschland sehr viel leichter zu absolvieren und mit viel geringeren Kosten verbunden ist, sodass Hochschulen – zumindest hypothetischerweise – auch zu Begegnungsorten unterschiedlicher Nationalitäten, sozioökonomischer Hintergründe, Gender und sexueller Identitäten, Altersgruppen und ethnischer Gruppen werden. Umso wichtiger ist es, dieses Potenzial zu erkennen und zu nutzen, indem es von den Lehrenden aktiv adressiert wird. Dies kann in unterschiedlicher Form stattfinden. Die erste Sitzung eines Seminars eignet sich beispielsweise gut dafür, die Studierenden auf die Bedeutung und Wichtigkeit einer aktiven Diskussionskultur hinzuweisen, die keine Meinung als absolut behandelt und durch gleichwertigen Austausch geprägt ist. Sinnvoll kann es daher auch sein, sich zuerst einmal gemeinsam die eigene Perspektive vor Augen zu führen. Eine erste Beschäftigung damit öffnet den Blick für dessen Fokusse, Befangenheiten und Einschränkungen. Wichtig ist allerdings auch, Studierende, die aufgrund wahrnehmbarer Merkmale einer vermeintlichen Minderheit angehören, nicht auf diese Rolle und Perspektive zu beschränken. Der oft gut gemeinte Ansatz, denjenigen „eine Stimme geben zu wollen“ kann oft das Gegenteil bewirken und in der Perpetuierung bestehender Vorurteile münden.
Als Studierender wünsche ich mir von Dozent*innen hinsichtlich einer heterogenitätsorientierten Lehre vor allem eine reflektierte Gelassenheit und neugierige Offenheit anderen Blickwinkeln gegenüber. Wer den eigenen Blick hinterfragt und thematisiert, der*die motiviert auch Andere, dasselbe zu tun. Hierzu gehört es, eine entspannte Unterrichtskultur zu schaffen, in der jede*r zu Wort kommen kann. So wird die Chance, die Heterogenität eröffnet, genutzt.
Quellenangabe
Börner, T. (2018): Heterogenität als Chance. het.blog – Perspektiven auf das Thema Heterogenität in Lehre und Studium, Blog-Beitrag Nr. 1, Potsdam: Netzwerk Studienqualität Brandenburg. (Online verfügbar unter: www.sqb-hetkom.de)
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz

Den vollständigen Blog-Beitrag finden Sie hier zum Download:
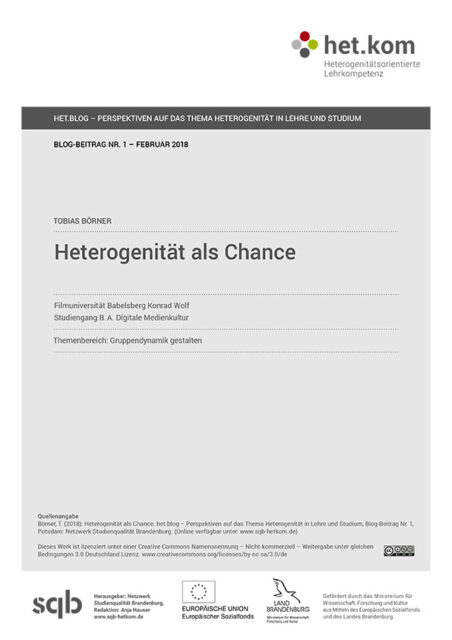
Ihr Kommentar zu diesem Beitrag?
Treten Sie in den Dialog über Heterogenität in der Lehre ein und schreiben Sie einen Kommentar zu diesem Beitrag.
Für die Veröffentlichung eines eigenen Beitrages nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.