Ankommen in der akademischen Fremde: Ein steiniger Weg
Als ich mein Studium der Erziehungswissenschaft an der Universität Potsdam begann, lag bereits ein abgebrochenes Studium hinter mir. Nach meiner abgeschlossenen Berufsausbildung hatte ich das Abitur auf dem Zweiten Bildungsweg absolviert und war anschließend nach Berlin gezogen, wo ich als erste in meiner Familie ein Studium aufnahm. Ich freute mich auf die neue Lebensphase und das unbekannte Terrain und blickte neugierig aufgeregt auf meinen Studienstart. Nach kurzer Zeit an der Uni musste ich jedoch feststellen, dass ich offensichtlich keine Ahnung davon gehabt hatte, was es bedeutete zu studieren und so wich meine naive Freude bald einem vagen Gefühl von Angst und Unsicherheit. Schon bald schlich sich zunehmend die Frage ein, warum es mir so viel schwerer fiel als meinen Kommiliton*innen, mich an der Uni zurechtzufinden und Zugang zu meinen Lehrenden und Kommiliton*innen zu bekommen. Irgendetwas schien nicht zu passen. Ich fühlte mich fremd.
Es vergingen zwei Jahre voller frustrierender Erfahrungen und Selbstzweifel, bis ich schließlich die Universität und den Studiengang wechselte. Gleich zu Beginn dieses zweiten Anlaufes fand ich mich in einem für alle Erstsemesterstudierenden obligatorischen Einführungskurs mit dem klangvollen Namen „Selbstreflexion und Planung“ wieder. In diesem Tutorium wurde uns „Erstis“ das Angebot gemacht, in einem eher informelleren Rahmen, Studienstrukturen und ‑abläufe kennenzulernen sowie in einen Austausch mit unseren Kommiliton*innen zu treten. Heute bin ich mir sicher: Dieser Kurs legte den Grundstein für das erfolgreiche Durchlaufen meines Studiums der Erziehungswissenschaft, da ich mich dort durch das Einbringen meiner Fragen rund ums Studium, aber auch meiner persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten erstmals als selbstwirksam und souverän begreifen konnte. Ich hatte Anknüpfungspunkte an die akademische Welt gefunden: Die Brücke war geschlagen.
Habitus in der Hochschule: Eine Frage der Passung
Es mussten Jahre vergehen, bis ich mir theoretisch-reflexiv erklären konnte, was ich damals nur auf einer Gefühlsebene zu spüren bekommen hatte: Der empirische Beleg, dass in keinem anderen Land der Welt die Variable der sozialen Herkunft so stark mit dem Bildungsverhalten korreliert wie in Deutschland [1]. Denn ob jemand den Sprung an die Hochschule schafft und dort erfolgreich studiert, ist bis dato vornehmlich ein Ergebnis kultureller Passung und weniger das Resultat einer objektiven Leistungsauslese. Für mich als sogenannte „Bildungsaufsteigerin“ und „nicht-traditionell Studierende“ aus „nicht-akademisierter Herkunftsfamilie“ war dies, wie eingangs geschildert, am eigenen Leib erfahrbar. Hemmnisse, Zurücksetzungen und Benachteiligungen, wie sie in Diskursen um Bildungsgerechtigkeit diskutiert werden, prägten insbesondere zu Beginn meines ersten Studiums meinen studentischen Alltag. Im Laufe meines Studiums lernte ich eine Erklärungsfolie kennen, die meine persönlichen Erfahrungen als Inkongruenzerfahrungen aus sozialer Disposition und dem unbekannten Feld der Hochschule theoretisch fassbar machte: das Habituskonzept von Pierre Bourdieu [2]. Entscheidend für einen erfolgreichen Übergang und die Integration in das Feld der Hochschule ist demnach, ob die als Habitus verinnerlichten kulturellen Muster, wie Haltungen, Vorlieben und Abneigungen der Studierenden, etwa in Bezug auf Kommunikationsweisen oder bestimmte Lerngewohnheiten, mit den für sie ungewohnten akademischen Strukturen und Abläufen ein Kohärenzerleben zulassen. Letztlich geht es somit um die Frage, ob Habitus und Struktur „eine Passung erlauben“.
Habitus-Struktur-Konflikte in Lehr-Lern-Settings: Eine subtile Form der Ausgrenzung
Bleibt diese Passung bzw. dieses Kohärenzerleben aus, lassen sich sogenannte Habitus-Struktur-Konflikte identifizieren [3]. Die durch diese Habitus-Struktur-Konflikte evozierten Gefühle wie Unsicherheit und Fremdheit können dann auch Auswirkungen auf Lehr-Lern-Settings haben und sich in der Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden niederschlagen. Konkret sichtbar wird dies, wenn Studierende sich aufgrund ihrer für sie spürbaren „Andersartigkeit“ bspw. seltener in Seminaren zu Wort melden oder in mündlichen Prüfungen schlechter abschneiden. Diese „geringere kulturelle und soziale Sicherheit im akademischen Milieu“ [4] kann die Basis für Missverständnisse bilden und die Lehr-Lern-Beziehung erschweren.
So war es für mich als in einem nicht-akademischen Elternhaus sozialisierte Studierende anfangs schwer, mich an Seminardiskussionen zu beteiligen und mir den Raum zu nehmen, meine eigenen Überlegungen zu einem Thema einzubringen. Stets tauchte in meinem Kopf die Frage auf, welchen Beitrag denn gerade ich leisten könne, wo doch andere bereits so viele kluge Sachen gesagt hatten. Ich war es qua Herkunft schlichtweg nicht gewohnt, mich in ein argumentatives Sparring mit anderen zu begeben und blieb daher trotz intensiver Textlektüre und Vorbereitung in Seminaren stumm. Meine schriftlichen Leistungen standen zu meiner mündlich sehr zurückhaltenden Performance daher in einem krassen Widerspruch und irritierten meine Dozierenden und auch mich selbst. Ich spürte, wie sich die soziale Distanz zu meinen Lehrenden und auch meinen vermeintlich eloquenteren Kommiliton*innen über die Zeit vergrößerte und reagierte darauf mit Rückzugstendenzen, welche von meinen Dozierenden wie auch Mitstudierenden teilweise als Desinteresse oder Ablehnung interpretiert wurden.
Dieser geschilderte Mechanismus erlaubt es schließlich, dass soziale Ungleichheiten als individuelle Begabungs- oder Neigungsunterschiede verschleiert werden. Da die Habitus-Struktur-Konflikte selten offen ausgetragen werden, sondern sich in subtiler Form offenbaren, nehmen die Studierenden die als spannungsvoll erlebten Zusammenhänge nicht als etwas soziologisch Bearbeitbares wahr. Sie tendieren dazu, die Erschwernisse den Unzulänglichkeiten der eigenen Person zuzuschreiben und diese als Versagen bzw. psychologische Störung zu individualisieren. Entsprechende Unterstützungs- und Beratungsangebote greifen dann oftmals nicht, da sie den Studierenden schlichtweg nicht bekannt sind oder von diesen nicht aufgesucht werden.
Habitus-Struktur-Reflexivität: Kommunikationsgelegenheiten in der didaktischen Lehrgestaltung schaffen
Möchten Lehrende nun die dargelegte Verquickung von sozialer Herkunft und Bildungsverhalten in ihren Lehrveranstaltungen didaktisch in den Blick nehmen, kann es sinnvoll sein, in Kommunikationsgelegenheiten zu investieren, welche die Studierenden zur Selbstreflexion und Interaktion einladen. Über die in den Veranstaltungen ablaufenden Austauschprozesse wird es den Studierenden dann möglich, ihre eigene Bildungsbiografie zum Lerngegenstand werden zu lassen und sich darüber in Bezug zur akademischen Welt zu setzen. Dieses Nachdenken und Ins-Reden-Kommen über sich selbst und die eigenen habituellen Dispositionen kann dazu führen, dass in der Folge Studien- und Lernpraktiken kritisch hinterfragt werden und ihnen lernend begegnet wird. Nicht-traditionell Studierende erlangen eine größere Sichtbarkeit und Selbstkompetenz und Studierende aus akademisierten Herkunftsfamilien werden aufmerksam gemacht auf differente Zugänge zum Studium. Gleichsam wird es auch den Lehrenden möglich, sich in Bezug auf ihren eigenen Habitus zu sensibilisieren und Kontextwissen zu erlangen, das zur weiteren Verständigung zwischen Lehrenden und Studierenden beiträgt.
Das Wissen um den Einfluss der sozialen Herkunft auf das Bildungsverhalten kann in Seminaren und Tutorien zum Thema gemacht werden.
Biografie als Thema
Durch die Offenlegung sozialer Ursachen als Erklärung für auftretende Irritationen und Konflikte ergeben sich neue Potenziale für die Lehrpraxis. Dies kann etwa geschehen, indem Lehrende Seminare konzipieren, die es den Studierenden erlauben, ihre Biografie „auf soziologisch“ [5] zu erzählen. Studierende sind dann eingeladen, die Berufs- bzw. Bildungsgeschichte ihrer Großeltern, Eltern und den eigenen Bildungsweg zu reflektieren. Durch diese zunächst schriftlich-individuell erarbeitete und später möglichst mündlich in Gruppensettings vorgestellte Selbstanalyse kann es den Studierenden gelingen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Kommiliton*innen ein besseres Verständnis zu erlangen.
Diagnose von Heterogenität als Methode
Das Thema Bildungsbiografie kann auch eingebracht werden, indem bspw. mit aktionssoziometrischen Methoden versucht wird, die Heterogenität der Studierenden anhand soziologischer Aspekte wie Alter, Herkunft, Geschlecht etc. räumlich abzubilden und in einer Gruppe allen sichtbar zu machen. Diese gruppendynamische Methode kann grundsätzlich auf alle Fachbereiche angewendet werden und bietet durch die Positionierung der Studierenden zu diesen Aspekten im Raum zahleiche Gesprächsanlässe. Ein Beispiel: In einem Seminar, welches das deutsche Bildungssystem zum Thema hat, könnte die*der Lehrende die Studierenden in einer Sitzung anregen, sich danach zu positionieren, ob mindestens ein Elternteil einen akademischen Abschluss hat oder nicht. Somit eröffnet die*der Lehrende einen Möglichkeitsraum, der es erlaubt, die Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems zu thematisieren und so die Inhalte der Sitzung direkt erfahr- und kommunizierbar macht.
Wie die vorgestellten Gestaltungsansätze auf Ebene der individuellen Lehrpraxis aufzeigen, benötigt es einen Zugang von zwei Seiten: Sensibilität und Reflexivität sowohl gegenüber der vorhandenen Habitualisierungen Studierender wie Lehrender als auch gegenüber der diese Habitus umgebenden Strukturen.
Schmitt fasst diesen Zusammenhang unter den Begriff der Habitus-Struktur-Reflexivität [6]. Dies hat Implikationen für die Lehrgestaltung:
- Bieten Lehrende Gestaltungsansätze, mit denen beide Seiten – d. h. habituelle und strukturelle Dimensionen von Lehren und Lernen – reflektierend in den Blick genommen werden, kann mithilfe des Austausches über die eigenen (bildungs-)biografischen Etappen ein geteilter kommunikativer Rahmen entstehen. Innerhalb dessen wird es den Studierenden dann möglich, Gefühle und Erfahrungen der Fremdheit und Isolation zu überwinden und ggf. erste Anerkennungserfahrungen in der Hochschule zu machen.
- Lehrende agieren nicht länger als reine Wissensvermittler*innen, sondern nutzen die wechselseitigen Dynamiken des Lehr-Lern-Verhältnisses und zeigen sich mehr als Lernbegleiter*innen und -berater*innen. Im Zuge des gemeinsamen Lehr-Lern-Prozesses kann es den Lehrenden gelingen, ihre Lehrpersönlichkeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Dies kann einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lehr-Lern-Beziehung leisten, da soziale Distanzen verringert werden und das Arbeitsbündnis im Sinne einer kooperativen Lernatmosphäre gestärkt wird.
Aus meiner eigenen akademischen Erfahrung weiß ich, dass ich mich in jenen Seminaren und Vorlesungen am ehesten „zu Hause“ fühlte, in denen ich mit meinem „habituellen Rucksack“ Andockpunkte ausmachen und mich verorten konnte. Sobald ich mich als Person mit meinen Erfahrungen und Bedürfnissen positionieren und im Austausch mit anderen reflektieren konnte, wurde es mir möglich, mich meiner selbst und meiner Umwelt zu verständigen und Lernprozesse anzuregen.
Habitus-Struktur-Reflexivität und Lehr-Lern-Kulturen: Weiter-Denken!
Bei all den geschilderten mikrodidaktischen Bemühungen von Lehrenden soll abschließend nicht unerwähnt bleiben, dass es bei einem Engagement einzelner Lehrender auf Ebene der individuellen Lehrpraxis nicht verbleiben kann. Durch meine eigene hochschuldidaktische Tätigkeit, insbesondere im ESF-Projekt „PRO^het – Gestaltungskompetenzen für eine nachhaltige heterogenitätsorientierte Lehre“, habe ich Einblick in Herausforderungen und Bedarfe Lehrender im Kontext heterogenitätsorientierter Lehrentwicklung gewonnen. Nicht zuletzt wurde daraus deutlich, dass eine Verschränkung individueller Lehrpraxis mit tragfähigen kollegialen Arbeitsstrukturen auf Fachbereichs- und Studiengangsebene für die nachhaltige Weiterentwicklung des Komplexes Lehre und Studium im Sinne einer diversitäts- und habitussensiblen Lehr-Lern-Kultur sinnvoll erscheint. Die Sensibilisierung von Lehrenden mittels hochschuldidaktischer Weiterbildungen, in denen eine Habitus-Struktur-Reflexivität als didaktisches Prinzip aufgegriffen und für die kompetenzorientierte Ausgestaltung von Lehre und Studium weitergedacht wird, kann richtungsweisend für eine zukunftsfähige Lehr-Lern-Kultur in Hochschulen sein.
Es bleibt abschließend festzuhalten, dass es in jedem Fall starker Agent*innen für Lehrentwicklungen auf allen Ebenen bedarf, um eine Veränderungswirkung zu erzielen. Denn nur wenn Modifizierungen auf individueller wie organisatorischer Ebene der Lehrgestaltung ineinandergreifen, indem sich kooperativ handelnde Akteur*innen in Lehre und Studium mit ihrer Agenda für eine konsequent kompetenzorientierte Lehrentwicklung stark machen, wird es zu einer längerfristigen und nachhaltigen Verankerung habitussensibler Praxen und Strukturen im Hochschulbetrieb kommen können. Das Ergebnis würde dann eine Lehr-Lern-Kultur in der Hochschule sein, welche die Studierendenschaft in ihrer Heterogenität ernst nimmt [7].
[1] Vgl. Ramm, M./Multrus, F./Bargel, T./Schmidt, M. (2014): Studiensituation und studentische Orientierungen. 12. Studierendensurvey an Universitäten und Fachhochschulen. BMBF. Online verfügbar: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-0-265900 (24.03.2021).
[2] Bourdieu, P. (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
[3] Vgl. Schmitt, L. (2010): Bestellt und nicht abgeholt. Soziale Ungleichheit und Habitus-Struktur-Konflikte im Studium. Wiesbaden: Springer VS, S. 53 f.
[4] Vgl. Bargel, H./Bargel, T. (2010): Ungleichheiten und Benachteiligungen im Hochschulstudium aufgrund der sozialen Herkunft der Studierenden. Arbeitspapier 202, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, S. 18 f.
[5] Schmitt, L. (2019): Der Herkunft begegnen… – Habitus-Struktur-Reflexivität in der Hochschullehre. In: Kergel, D./Heidkamp, B. (Hg.): Praxishandbuch Habitussensibilität und Diversität in der Hochschullehre. Prekarisierung und soziale Entkopplung – transdisziplinäre Studien. Wiesbaden: Springer VS, S. 456.
[6] Vgl. ebd., S. 451ff.
[7] Vgl. Jankow, H./Baldauf-Bergmann, K. (2019): Hochschuldidaktische Angebote für eine diversitätssensible Lehre im Kontext der Öffnung der Hochschulen. In: Kergel, D./Heidkamp, B. (Hg.): Praxishandbuch Habitussensibilität und Diversität in der Hochschullehre. Prekarisierung und soziale Entkopplung – transdisziplinäre Studien. Wiesbaden: Springer VS, S. 695–715.
Quellenangabe
Ullmann, S. (2021): Habitus-Struktur-Reflexivität für eine gelingende Lehr-Lern-Beziehung. het.blog – Perspektiven auf das Thema Heterogenität in Lehre und Studium, Blog-Beitrag Nr. 5, Potsdam: Netzwerk Studienqualität Brandenburg. (Online verfügbar unter: www.sqb-hetkom.de)
Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz
![]()
Den vollständigen Blog-Beitrag finden Sie hier zum Download:
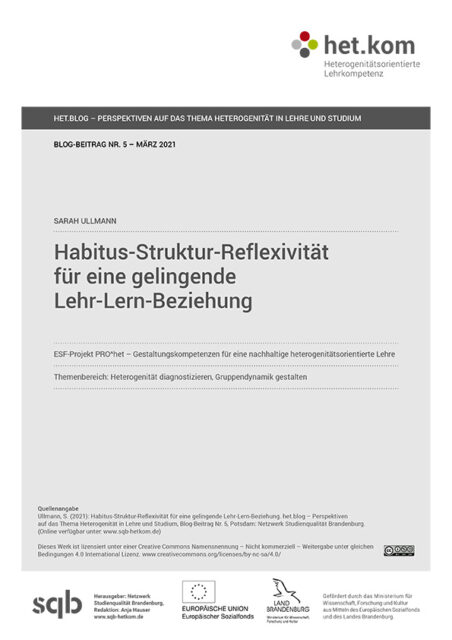
Ihr Kommentar zu diesem Beitrag?
Treten Sie in den Dialog über Heterogenität in der Lehre ein und schreiben Sie einen Kommentar zu diesem Beitrag.
Für die Veröffentlichung eines eigenen Beitrages nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.